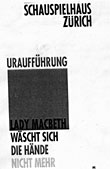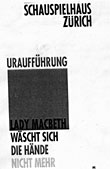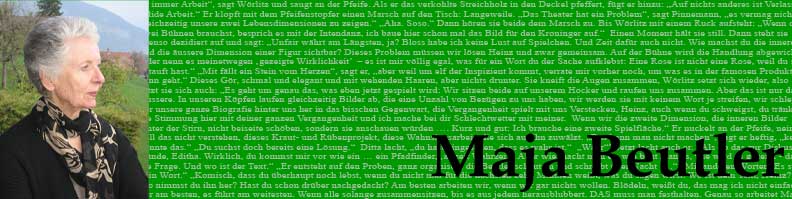| Theater |
 |
Das Blaue Gesetz
UA 1979 am Städtebundtheater Biel-Solothurn
|
Vergessen Sie nicht: Sie bleiben lebenspflichtig, Sie bleiben lebenspflichtig, Sie bleiben lebenspflichtig.
Lesebeispiel:

|
- Weltwoche
- NZZ
- Luzerner Neuste Nachrichten
Lesebeispiel:

|
|
LAUTSPRECHER: Schwester Annette - bitte kommen, bitte kommen. (Alarmsignet)
Doktor Manz kommt mit einem Statisten an die Rampe - der Statist trägt Blaue Profilstangen, Dr. Manz zieht bei Block D die Hölzchen weg und schlägt die erste Profilstange ein. Der Statist steigt plötzlich ins Publikum hinunter und holt ein paar Rote Scheine herauf, die Wirsig vorher verteilt hatte. Er reicht sie Dr. Manz.
Manz: (zum Statisten) Das ist unglaublich. Es gibt gar keine Roten Scheine ohne Namen, ist ja längst automatisiert: In der roten Liste wird der Name eingesetzt, auf der Blauen Liste automatisch ausgestrichen. Name drauf - Name draus. Völlig automatisch. Das hier gibt es gar nicht. Aber ich habe es kommen sehen ... (Manz lässt die Profile liegen und geht mit den Scheinen schnurstracks ins Rote Amt zu Wirsig.)
9. Szene, im Roten Amt
Manz: Was haben Sie dazu zu sagen: Im Stadtpark gefunden.
Wirsig: Wenn Sie was Rotes auf dem Herzen haben, können Sie warten bis um Zwölf. // Gandolfi Pietro sei erlöst.
(Die Rote Schwester nimmt den Roten Schein und will ihn am Blauen Leintuch des Gandolfi Pietro festmachen – Dr. Manz fährt dazwischen.)
Manz: Das möcht ich erst noch kontrollieren, Schwester. (zu Wirsig, dem er den Schein aus dem Stadtpark zeigt:) Wissen Sie, was das heisst?
Wirsig: Das heisst: Ich müsst’ noch den Namen einsetzen.
Manz: Das heisst: Es sind ungültige Rote Scheine in Umlauf. DAS haben Sie erreicht, mit Ihrer Gesuchspraxis. Genau, was ich immer befürchtet habe: UNREGELMÄSSIGKEITEN, Herr Wirsig! Von heute ab: Gesuche nur noch JA, wenn ICH sie bewillige.
Wirsig: SIE haben die Krankheiten ausg'rottet — ICH darf jetzt die Erlösung in Griff bekommen. . .
Manz: (zu den Roten Schwestern) Kontrollieren wir die Erlösungs¬liste von heute. (zu Wirsig) Und wenn ein einziger Name drauf steht, den ich persönlich nicht bewilligt hätte, dann ...
Wirsig: Dann was, Manz?
Manz: Ich kann beurteilen, wer LEBENSPFLICHTIG ist und wer nicht, ICH bin Mediziner.
Wirsig: Und ICH ein dummer Malermeister, der den lieben langen Tag wieder gutmacht, was Sie drüben versauen. (zu den Schwestern) Freibier für alle! Wir hören auf, dem Manz seine Schandfleck’ zu tilgen.
Manz: Zimmerstunde. Morgen früh stellen wir gemeinsam die Erlösungsliste zusammen, Jahrgang 12 nach Alphabet, plus EIN Gesuch, das ich bewillige. (Rote Schwestern ab)
Wirsig: (packt Manz am Kragen) Hier drin sagt der WIRSIG, welches Gesuch bewilligt wird. Ich hab mir die Erlösung aus Ihrem Schlamassel einfallen lassen. Radieren Sie doch endlich das Altwerden aus - dann brauchen Sie mich eh nicht mehr.
Manz: Ich sehe meine Grenzen durchaus. Unbestritten: SIE gehören zum System. Mit andern Worten, wir haben dasselbe Interesse: Die Organisation nicht aus dem Griff zu verlieren, unter keinen Umständen, und an gar keinem Punkt.
(Schwester Annette kommt in die Preziosa. Manz zieht einen überdimensionierten Roten Schein aus dem Arztkittel und hält ihn Wirsig unter die Nase.)
Manz: Hier mein Entwurf: Die Roten Scheine werden zum Staatspapier. Statt Gnade vor Recht LINKS ein Bleifaden, RECHTS die Rose als Wasserzeichen.
Annette (à part): Dann bleibt nur noch die Angst frei. (Wirsig und Manz drehen sich überrascht nach ihr um)
Wirsig/Manz: DIE ANGST?
(LICHT AUS)
LAUTSPRECHER: Block A, B und C: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir offene Fenster nicht länger tolerieren können. Es geht um Ihre Lebenspflicht. Wir danken für Ihr Verständnis
Regieanweisungen zu Szene 10:
Zwei neue, diesmal rotblaue Werbeplakate, werden im Lauf der Szene in den Zuschauerraum gehängt:
- AUCH FAMILIEN SIND EIN ZEITVERTREIB
- LIEBER ANGEHÖRIGE ALS SCHLAFPILLEN
Erst während der Rede von Manz schlägt ein Statist an der Rampe vorn ein Protestplakate ein: BLAU HEISST NOT – HILF UNS ROT

Weltwoche | NZZ | Luzerner Neuste Nachrichten
Weltwoche: Szenen aus der Todesstation
Maja Beutlers erstes Stück, «Das blaue Gesetz», am Städtebundtheater uraufgeführt
Ein Teil Kroetz, ein Teil Beckett, ein Teil Dürrenmatt, gut schaumig schlagen und mit einer Prise Orwell würzen: dem dramatischen Erstling von Maja Beutler, bislang nur als Prosaistin bekannt, sind die Ahnen noch anzumerken. Qualitäten werden aber trotz fragwürdiger Regie sichtbar.
Es sind sozusagen zwei Theaterabende: der eine findet statt; den andern kann man sich vorstellen. Und es ist keine mühsame und vergebliche Vorstellung. Denn die Berner Autorin, die für ihren Prosaband «Flissingen fehlt auf der Karte» zu Recht gelobt worden ist, hat mit «Das blaue Gesetz» durchaus kein banales Stück geschrieben. Sie hat sich die schwierige Aufgabe gestellt, Realität nicht mit realistischen Mitteln einzubringen, sondern in einem absurden Theaterstück, wobei sie allerdings auf eine interessante Weise in den absurden Gesamtrahmen ganz reale Szenen und Personen plaziert. Unbekümmert stellt sie Figuren von Kroetz, von Beckett und von Dürrenmatt nebeneinander oder legt die drei Dimensionen in ein und derselben Person an.
Überraschenderweise leuchtet die Konzeption dieser Mischung absolut ein. Was die Ausführung angeht, sind Einwände anzubringen. Die Dürrenmattsche Dimension des Grotesken und Spektakulären liegt dieser Schriftstellerin nicht. Aber gerade darauf legt sie unverkennbar besonderen Wert.
Und statt sich ganz auf ihre eigentliche Stärke — die «arme», unauffällige, präzise Sprache oder den dichten, knappen Dialog — zu verlassen, erfindet Maja Beutler dann Bühnenwirksamkeit dazu, die zum Selbstzweck wird.
Es gibt jedoch auch in diesem Bereich noch genug Gelingen. Der mehrmalige aggressive Einbezug des Publikums ins Spiel beispielsweise, oder die szenische Verzahnung zweier verschiedener Spiel- und Dialogebenen — das ist mit Scharfsinn ausgedacht und ausgeführt und wirkt stärker als einige Elemente der realistischen Schicht. Der Herkunftskomplex des Stadtmagnaten Wirsig oder die Liebesgeschichte sind etwas billige Beigaben zur bedrängenden Problematik des Stücks, das eine illusionslose Abrechnung vornimmt mit der Entwicklung zur verwalteten Gesellschaft.
Der Malermeister Wirsig setzt es durch, dass alle über Fünfundsechzig-jährigen aus dem Verkehr gezogen und in der von ihm erbauten blauen Station gewaltsam zur Ruhe gesetzt werden. Die Alten selber dringen darauf, den «blauen Dress» anzuziehen und unter dem «blauen Gesetz» zu leben, bis sie feststellen, dass der «demokratische Gleichschritt» in der blauen Station eine permanente Vergewaltigung und die durchorganisierte Existenz, mit der
Verpflichtung, jeden Tag «lebenspflichtig» zu stempeln, ein erbärmliches Dahinvegetieren ist. Wirsig, der vom Chefarzt Dr. Manz aus der blauen Station hinausgedrängt wird, sieht angesichts des wachsenden, nicht erfüllten Erlösungsbedürfnisses ihrer Insassen seine nächste Chance: die Erbauung und Inbetriebnahme der «roten Station», die, wie die blaue das Altern, nun das Sterben, den Tod regelt und in den Griff bekommt. Die Stationen, die einander zunächst konkurrenzieren, spannen am Ende zusammen, die einzelnen Menschen sind ihnen rettungslos ausgeliefert. Hoffnungsvollere Ausblicke gestattet sich Maja Beutler nicht — gerade darum ist das Stück bedenkenswert.
Dieser Eindruck hält sich, trotz der Inszenierung des jungen Federico Pfaffen und Karl Weingärtners frugalem Bühnenbild, die allerhand dazutaten, das Stück in Show und Spektakel zu ersäufen. Der Regisseur hat zudem recht unselig gekürzt, dort nämlich, wo die eigentlichen Qualitäten herauszuarbeiten gewesen wären, in den Dialogen und Argumentationen. Was er dafür hinzugedichtet hat (die aktualisierende Szene, wo Wirsig die morsche Bestuhlung des Bieler Stadttheaters inspiziert) oder wie er eine kurze Szenenanweisung der Autorin (Annette Wirsig zertritt eine Rose) zu einer langfädigen Szene ausbaut, lässt einen den Verlust des ursprünglichen Textes auch nicht gerade leichter verschmerzen.
Heinz F. Schafroth
NZZ: Uraufführung in Biel
Die totale Sozialisieriing von Leben und Tod
«Das blaue Gesetz» von Maja Beutler
cbg. Zu Beginn des Bühnenerstlings «Das blaue Gesetz» von der Berner Journalistin und Erzählerin Maja Beutler, der im Stadttheater Biel als neuerlicher Beitrag des Städtebundtheaters zur Nachwuchssuche für das schweizerische Schauspiel zur Uraufführung gelangte, lässt ein junger Mann seinen ganzen Unmut gegen den Bau eines Altersheims und gegen die Absicht seines Vaters aus, dort einzuziehen. Warum solch heftiges Sich-Sperren gegen eine soziale Institution? Und warum erwürgt eben dieser gleiche Sohn zehn Jahre später in dem unterdes in Funktion getretenen Heim den am Rande des Komas nur noch dahinvegetierenden Vater? Nun, die Autorin breitet in ihrer fast abstrakt konstruierten — an den Expressionismus von Yvan Goll oder Georg Kaiser erinnernden — Modellfabel am Beispiel einer bizarr überorganisierten Altenhilfe und einer (noch utopischen, aber denkbaren) automatischen Sterbehilfepraxis die erschreckende Vision einer zu eiskalter Routine erstarrten staatlichen Sozialleistung aus. Im Vergleich zu solcher Automatisierung eines wichtigen Dienstleistungszweiges durch nur noch mechanisch reagierende Ärzte und Helferinnen ist dann die sanfte, aber tödliche Tat des jungen Mannes gleichsam die humanere Handlungsweise.
In dieser Fabel bekommen die Politiker wie die ausführenden Institutionen durch bewusste Überzeichnung ihr Teil ab: der Stadtrat Dr. Manz als Leiter der «vollautomatisierten» Stätte für alte Menschen, in der vom Zeitungslesen bis zur Einschlaftablette alles genau nach minuziösem Zeitplan geregelt wird, und der Stadtrat Wirsig als Erfinder der Gegeninstitution, in welcher man auf Bestellung durch einen schmerzlosen Stromschock ins Jenseits befördert wird — legal, versteht sich; denn in dieser Utopie von morgen steht Sterbehilfe als Sozialleistung im Programm der Parteien und der Regierung.
So erzählt, hat Maja Beutlers Stück eine sehr wichtige kritische Aussage zu unserem gefährlich unbekümmerten Vertrauen in die Sozialisierung von immer mehr Teilen unserer privaten Existenz zu bieten. Um so mehr ist zu bedauern, dass die Autorin den Stoff und das Thema nur recht oberflächlich zu bewältigen vermochte. Die Erfindung der Fabel haftet zu sehr an äusseren Effekten, wird sprachlich nicht vertieft und hinterlässt einen fad-künstlichen Eindruck; Wünschenswert wäre gerade hier noch etwas mehr an dramaturgischer Starthilfe von einem Theaterteam (Direktor Alex Freihart und Dramaturg Manfred Schwarz), das sich gerade die Förderung unbekannter Talente vorgenommen hat.
Auch hätten eine stärkere Regiehand als die des zwar einfallsbemühten, aber doch am Äusseren haftenbleibenden Federico Pfaffen und ein weniger vordergründiges Spiel der Darsteller aus dieser Inszenierung (im Bühnenbild von Karl Weingärtner und in den bewusst uniformen Kostümen von Michaela Mayer) noch mehr Tiefen ausgelotet. Denn auch heute gilt noch Hans Schweikarts Faustregel: Schwache Stücke brauchen starke Regisseure und Schauspieler.
Luzerner Neuste
Nachrichten: Uraufführung des Städtebundtheaters Biel-Solothurn
<Das blaue Gesetz>, der Erstling von Maja Beutler
Von Beatrice Eichmann-Leutenegger
Das Städtebundtheater Biel-Solothurn hat es gewagt, den dramatischen Erstling einer Autorin zu realisieren: Maja Beutlers hintergründiges Schauspiel in drei Bildern, «Das blaue Gesetz», ist ein Beitrag zum Thema des Alterns und Sterbens, in einer überorganisierten Gesellschaft der Zukunft.
Die Risiken liegen in einem solchen Fall auf zwei Seiten: Einerseits wagt eine Autorin den Sprung von Prosatexten zur dramatischen Arbeit, die wiederum gänzlich neue Fragen der formalen und inhaltlichen Bewältigung aufwirft; anderseits erklärt sich eine Bühne, die weit mehr noch als grössere Häuser mit den bekannten materiellen Schwierigkeiten eines Theaters zu kämpfen hat, bereit, ausgerechnet ein solches erstes Opus zu übernehmen, wobei der Seitenblick auf die zu füllende Kasse grosszügig ausbleibt. Gerade dies ist im Fall des Städtebundtheaters Biel-Solothurn vorweg lobend zu erwähnen.
Maja Beutler, 1936 geboren und in Bern aufgewachsen, trat 1976 mit dem Erzählband «Flissingen fehlt auf der Karte» (Zytglogge-Verlag) an die Öffentlichkeit, einem Erstling, dem nach den Worten Kurt Martis Erstlingscharakter kaum anhaftete. Es folgten kurze Texte für Anthologien, sowie mehrere Sendungen für das Radiostudio Bern — letztere vielleicht auch als Zwischenstationen auf dem Weg zur dramatischen Arbeit zu betrachten. «Das blaue Gesetz» nun knüpft in manchen Belangen an den erwähnten Erzählband an. In beiden dringen die Fragen nach dem Leben, dem Altern und Sterben durch, in beiden durchbricht fast unmerklich die Surrealität das scheinbar sichere Gefüge des Alltags.
Was verordnet «Das blaue Gesetz»? Es verpflichtet — als utopische Vorstellung einer nahen Zukunft — die Bürger seines Staates zum Leben um jeden Preis in einer Gesellschaft, die ähnlich Aldous Huxleys «The; brave new world» der totalen Planung, ja Verplanung anheimfällt. Die Fürsorge gerät zum Selbstzweck, das Weiterlehen zur Strafe für jene, die sterben möchten, dafür aber noch nicht vorgesehen sind. Maja Beutler hat damit ein wichtiges Thema aufgegriffen, ein Thema, das ihr aus bisherigem Schreiben, Erfahren und Erleiden heraus bedenkenswert geworden ist. Ihre wenigen Personen siedelt sie in einer Welt an, die zu Beginn des ersten Bildes vertrauter Alltäglichkeit ähnlich sieht; im Verlauf des Stückes aber verfremdet sich die Umgebung gegen das Absurde hin — als Zeichen für die zunehmende Umklammerung der Menschen durch «Das blaue Gesetz». In teils sehr pointierten Aussagen und in einigen eindringlichen dramatischen Momenten spricht sich das Anliegen der Autorin aus, ein solch unmenschliches System, der Vermassung und Verplanung das Ich zu bewahren, dem Leben und Tod sein Recht zu belassen. Die einzelnen Figuren des Stückes sind als Typen deutlich herausgearbeitet: Wirsig als allzu jovialer Stadtrat etwa, Dr. Manz als versierter Medizinaltechniker, Hannes Parschau als angepasster Bürger, sein Sohn Toni dagegen als der jugendliche Rebell; er besonders markiert das Ich der Autorin. Das Publikum selbst wird immer wieder direkt ins Geschehen einbezogen, agiert als Bürger unter diesem blauen Gesetz. — Die Aussage des Stückes bleibt nachhaltig, auch wenn Maja Beutler die formale Bewältigung nicht in allen Teilen geglückt ist; häufig reihen sich Dialoge oder Slogans einfach aneinander, ohne durch ein bühnenge¬rechtes Movens vorangetrieben zu werden, so dass diese Handlungskargheit gewisse Längen einlässt.
Die Inszenierung selbst — unter der Regie von Federico Pfaffen — war durch Maja Beutlers Stück überfordert. Nicht nur fehlen zum Teil die technischen Einrichtungen, um den Ablauf flüssig zu gestalten; nicht nur mangelt es zum Beispiel der Solothurner Bühne an Tiefe, um die nötigen Dimensionen suggerieren zu können, statt den Eindruck der räumlichen Überbelastung aufkommen zu lassen. Auch das Klima dieses Dramas hat Pfaffen nicht erfasst. Statt der geforderten allmählichen Verfremdung ins Surreale hinein, stopfte er die Bühne mit Versatzstücken voll, die in keinem Bezug zueinander standen und sich oft nur wie Übungen in vordergründiger Theatralik ausnahmen. Es drängte sich der Verdacht auf, die Regie fühle sich im Umgang mit den künstlerischen Mitteln (Bühnenbild, Kostüme, Technik) unsicher, vergreife sich oft in deren Dosierung und versuche dagegen, von solchen Schwachstellen durch eine unmotivierte Hast von Auftritten, durch komisch wirkende Ausbrüche einzelner Schauspieler abzulenken. Da liess sich jedoch ein Dilettantismus im negativen Sinn nicht verleugnen. Gerne hielt man sich in dieser Verlegenheit an die guten Rolleninterpretationen durch Ulrich Radke als Wirsig, Winfried Goerlitz als Dr. Manz, Renato Grünig als Toni, während Claudia Federspiel in der deutlich konturierten Rolle als Frau Parschau erst im dritten Bild zu überzeugen vermochte. Die Hintergründigkeiten in Maja Beutlers Stück brachen jedoch nicht aus.

|
 |
Der Traum
Ballettlibretto
1981, Theater National, Bern mit der Truppe von Roni Segal, Haifa
|
Habe ich nicht einen Kopf, der nur mir gehört? Und Gedanken, die nur ich denke?
Lesebeispiel:

|
|
|
1.BILD: WERDEN
MENSCH: Bin ich ...
das Chaos?
Heisse ich .. .
Welt?
Sind meine Finger
Feuerzungen?
Rede ich
Steine?
ADAM: Alles bist du,
bevor du selbst wirst.
SEHERIN: Alles hast du,
dich selbst
musst du machen.
MENSCH: Ich?
Mich?
Habe ich nicht
einen Kopf,
der nur mir gehört?
Und Gedanken,
die nur ich denke?
Kann ich mir
die Welt nicht vorstellen,
wie ich will,
Und mich selbst,
ganz wie ich will?
SEHERIN: Das Heute ist geführt
vom Gestern.
MENSCH: Habe ich nicht zwei Hände und greife
nach was ich will?
Habe ich nicht zwei Füsse und gehe
wohin ich entscheide?
SEHERIN: Bevor deine eigene Zeit aufzieht
bist du Vergangenheit.
MENSCH: Kann ich mir MORGEN
nicht vorstellen wie ich will?
Morgen plane ich
in meinem Kopf.
SEHERIN: Vergangenheit bist du
ADAM: Wasser, Feuer, Luft, Stein,
der erste Tag der Welt bist du.
Beweg deine Füsse vorwärts
du kommst zurück
an den Anfang.
MENSCH: Sind meine Augen Planeten?
Ist meine Zunge eine klebrige Schnecke?

|
 |
Das Marmelspiel
UA 1985 am Stadttheater Bern,
(Verlag der Autoren, Frankfurt a/Main) |
Irma: Spiel endlich etwas Vernünftiges. Dieses Geräusch macht mich wahnsinnig. Köpfe, die rollen.
Lesebeispiel:

|
- Schweizer Monatshefte
- Aargauer Zeitung
- NZZ
Lesebeispiel:

|
|
22. Szene
(Im Gartenrestaurant, Ein kalter Winternachmittag. Ninas Drachen liegt am Boden. Die Gartenstühle stehen auf den Tischchen und sind mit Plastik zugedeckt. Pedroni kommt, mit einem kleinen Handköfferchen, nimmt einen Stuhl herunter und setzt sich. Von der andern Seite kommen Irma, das Kind und Frau Wyttenbach. Irma trägt einen verschnürten Schuhkarton, Frau Wyttenbach ihre Markttasche. Das Kind hebt den Drachen auf, er ist beschädigt, die beiden Frauen nehmen das Kind in die Mitte, heben es samt dem Drachen hoch.)
FRAU WYTTENBACH Und hopp, kannst du fliegen. Aber wir landen, für das Bier. Besser als alle andern versteh ich Sie, Frau Becher: Bei mir registriert überhaupt niemand, was ich leiste.
IRMA Wenn der Staub gewischt ist, ist er weg.
FRAU WYTTENBACH Wissen Sie, was meiner sagt, am Abend? "Von was bist du ausgelaugt? Ist doch alles tip-top." Nein, nein, machen Sie sich nur keine Vorwürfe wegen dem bißchen malen. Gell nicht, Hardy? Und hopp, kannst du fliegen.
(Stalder tritt aus der Tür des Cafés, er zieht die Augenwinkel nach hinten, um einen Chinesen zu imitieren.)
STALDER Ninang - tschautschau - i gang.
FRAU WYTTENBACH Ich glaub, ich hol das Bier ein andermal.
STALDER (sieht Pedroni) Heilandsack, bin ich spät dran. Schad, Herr Pedroni. (Er geht an den Frauen vorbei.)
Immer dasselbe: Die besten müssen gehen. (Er geht ab.)
FRAU WYTTENBACH Jesses, ich hätt ihn nicht wiedererkannt.
IRMA So ein Jammer.
DAS KIND Juhuu!
PEDRONI Juhuu!
IRMA Bscht, Hardy. Man darf ihn nicht stören in seinem Zustand,
DAS KIND Juhuu!
IRMA Nein, hab ich gesagt. Zur Belohnung darfst du die neuen Schuhe anziehen zu Haus, Und hopp, kannst du fliegen, schnell, geh voraus. (Das Kind geht ab, mit Schuhkarton und Drachen.)
IRMA (deutet auf Pedroni) Mein Gott, wenn ihm nur nichts passiert.
FRAU WYTTENBACH Vor unsern Augen? Und allein ist er auch. Warum ist er nicht im Spital?
IRMA Er will doch nicht sitzen bleiben, in der Kälte draußen?
(Pedroni hustet.)
FRAU WYTTENBACH Da holt sich ja jeder den Tod.
IRMA Bscht. Ich muß an meinen Vater denken: wie er. So hat er dagesessen, zuletzt. Nach über fünf Jahren hab ich geträumt von ihm. Er liege in einem leeren Haus, ganz nackt. Und eine Stimme hat gerufen: "So ein Jammer. Nicht ein einziges Hemd aus grünen Blättern hast du ihm genäht."
FRAU WYTTENBACH Woher man das alles nimmt? Gehen wir.
(Pedroni hustet. )
IRMA Guten Tag, Herr Pedroni, wollen Sie nicht in die Wärme?
PEDRONI Drinnen erstick ich - hier huste ich nur ... Stört es die Damen? Oder darf ich Sie zu einem Punsch verführen?
FRAU WYTTENBACH Immer derselbe! Wie sähe das denn aus: Schnaps, am hellichten Tag? Ich ruf die Nina. (Laut.) Nina!
IRMA Weiß es Ihre Frau?
PEDRONI Daß ich Sie verehre? Bestimmt. Sonst werde ich es ihr schonend beibringen.
FRAU WYTTENBACH Etwas Heißes wird Ihnen gut tun.
PEDRONI Ihnen nicht? Die Kälte ist dieselbe. Ecco: Sie sind meine Gäste.
FRAU WYTTENBACH Ihre Frau weiß also Bescheid, wo Sie sind?
PEDRONI Wenn Sie Sturm läuten an unserer Tür, sind Sie vielleicht die Erste mit der frohen Botschaft. (Er hustet.)
FRAU WYTTENBACH (zu Irma) Wer trägt denn die Verantwortung? (Sie geht ab.)
IRMA Schade. Hardy wartet auf mich. Aber ich bin froh, daß Sie wieder zu Hause sind, Herr Pedroni. Sie haben uns gefehlt.
(Sie geht ab.)
(Das Kind rennt herbei, mit dem Schuhkarton.)
DAS KIND Juhuu!
PEDRONI Juhuu! (Er hustet.)
DAS KIND Du hustest.
PEDRONI Mein Husten und ich, wir werden gleich alt werden.
DAS KIND Wie alt?
(Nina kommt)
PEDRONI Signorina Nina fina - Das Heimweh hat mich gepackt. Beinah wie früher: Wenigstens wackelt das Tischchen noch. Und der Stuhl ist auch immer noch zu hart fürs Jüngste Gericht. Aber für ein Bierchen …
NINA Temperiert?
PEDRONI Hörst dus, amico? Sie will mich krank machen. (Zu Nina) Wie immer will ich es: beschlagen vor Kälte.
NINA Von mir aus zugefroren.
DAS KIND Ich hab neue Schuh.
PEDRONI Also noch eine Bestellung, Signorina: Wir müssen feiern.
DAS KIND Ich darf nicht
PEDRONI Weil ich krank bin? Die Schuhe sind trotzdem neu, amico.
NINA Ein Bier für Sie, ne Bettflasche für mich, und du? Heiße Schokolade?
PEDRONI Macchè. In dem Alter. Auch etwas Eiskaltes. Coca Cola.
(zum Kind) Hab ich nicht recht?
(Nina geht ab)
DAS KIND Darfst du alles?
PEDRONI Jetzt ist es leicht.
DAS KIND Schön ist es jetzt.
PEDRONI Was kann uns passieren? Alle sind eingesperrt in ihre Häuser.
NINA (kommt mit den Getränken) Na dann Prost im Schnee.
PEDRONI Salute. (Nina geht ab)
Weißt du, was ich heute Nacht gehört habe? Die Wolken.
DAS KIND Ich auch.
PEDRONI Du auch? Das wollen wir feiern, wir beide. (Er stößt mit dem Kind an.) Auf die Wolken, amico.
Und bald wird es blühen. Dann werden wir wieder feiern. Jedes Blatt.
IRMA (Im off) Hardy. Bernhard.
(Das Kind rutscht blitzschnell vom Stuhl und rennt weg. Pedroni wirft ihm den Schuhkarton nach.)
PEDRONI Die Spuren immer tilgen, amico. (Irma und Nina kommen gleichzeitig)
PEDRONI Die mütterliche Geheimpolizei kreuzt schon auf. Sollen wir lügen?
(Er steht auf, holt den Schuhkarton, reicht ihn Irma.) Ein junger Mann war hier. Und ein alter.
IRMA Danke, Herr Pedroni, danke für alles. (Sie geht ab.)
PEDRONI Zahlen.
NINA Viersechzig.
PEDRONI (kramt im Geldbeutel) Kummer, Nina fina? Schämen Sie sich nicht, daß ich es bemerkt habe. Ich bin Experte geworden. Auch ein großer Schatten? Ihn wegscheuchen müßte man können. Oder vielleicht ... die Hand aufmachen. Das könnte man lernen - loszulassen, meine ich. Nur gernhaben muß man vorher können.
(Er geht mit dem Köfferchen ab. Nina schneuzt sich. Frau Wyttenbach und Anna kommen eilends.
FRAU WYTTENBACH jetzt ist er weg. Aber DA, da hat er gesessen.
ANNA Und gestern hat er Sauerstoff gebraucht im Spital. Das gibt es doch gar nicht, von einem Tag auf den andern. An was soll ich mich halten?

Schweizer Monatshefte | Aargauer Zeitung | NZZ
Schweizer Monatshefte
für Politik, Wirtschaft, Kultur.
November 1985, Heft 11
SZENE SCHWEIZ
Die Flügel locker halten
Zur Berner Uraufführung von Maja Beutlers Drama «Das Marmelspiel»
Es gibt weibliche Dramatiker auch in der Schweiz, zwar nicht in grosser Zahl; sie kommen, wie ihre männlichen Kollegen in den Genuss der von der Trägergemeinde der Theater und vom Bund finanzierten Dramatikerförderung und erhalten damit die Gelegenheit zu praktischer Arbeit (nicht nur flankierender Beobachtung) an einem unserer Theater. Eine Form der Kulturförderung übrigens, eine der wenigen, bei der man den Ertrag und Sinn in einigen Jahren immerhin wird feststellen - wenn auch nicht genau abmessen und abwägen - können.
Maja Beutler hat ihr neues, ihr zweites Stück konzipiert, während sie als Hausautorin am Stadttheater Bern arbeitete; es ist jetzt, bereits ausgezeichnet durch den Welti-Preis, auf der grossen Bühne dieses Hauses zur Uraufführung gebracht worden.
Das Drama, dessen 26 Szenen gemäss dem Titel wie Marmeln hintereinander abrollen sollen, alle gleichzeitig in Bewegung, aber nicht gleichzeitig beleuchtet, ist, vordergründig gesehen, ein Stück über die Enge aller Tage, über die Not der kleinen Leute, die miteinander leben und nebeneinander vorbeireden, mit einer ungestillten Sehnsucht und ohne die Fähigkeit, diese Sehnsucht in etwas anderes als in Unzufriedenheit, schlimmer, in Gehässigkeit gegen den anderen umzuwandeln. Ein Stück (und damit gehe ich über das eben Gesagte schon hinaus), in dem nichts geschieht - nichts als das Allgemeinste und Unausweichliche: dass einer stirbt. Einer, der nicht mehr jung ist und doch zu jung, und der einen Tod hat, wie ihn alle haben könnten: einen unspektakulären Krebstod. Nur - wie er mit diesem Tode umgeht, das schon gibt der Figur und gibt dem Stück, diesem Stück der kleinen Leute, Grösse. Von diesem Tode her werden die Alltagsszenen beleuchtet; sie werden gleichsam durchscheinend, und wenn der Anfang noch als ein kleinbürgerliches Panoptikum wirken könnte, so ändert das - und es müsste auch in der Aufführung ändern! - mit dem ersten Auftritt des noch ohne sein Wissen bereits todkranken Schneiders Pedroni; der ein Handwerker ist und ein Grandseigneur in einem, und obendrein, ganz bewusst, ein Künstler; der mit dem Stoff umgeht, als schaffe er daraus der Welt ein Kleid. Nicht dass das Stück jetzt zu einem Totentanz würde; denn Pedroni bleibt noch als ein vom Tod Gezeichneter, vor dem die Gesunden mitleidig-erschreckt zurückweichen, ein lebendiger Mensch und bringt, sobald er auftritt, einen unangestrengten Lebensmut mit sich.
Dazu steht nicht in Widerspruch, dass er, noch ehe er um seine Krankheit weiss, sich wünscht, er könnte in einem Luftballon wohnen, und dass er, kaum hat er sein Todesurteil vernommen, beschliesst, die Welt nun «loszulassen». Das Luftige und das Lebendige sind in diesem Stück untrennbar, bis zur Identität verbunden. Das ist ungewohnt; erkennt man es nicht, verfehlt man etwas vom Zauber und von der Tiefe des Textes.
Beides zeigt sich auch an einer anderen Figur, die, im Gegensatz zu Pedroni, ganz im Leben steht und ihm doch entspricht: die Kellnerin Nina. Dass sie ihre Flügel locker halte, ist einer ihrer ersten Sätze, ja, damit eigentlich beginnt das Stück; keine Wurzeln will sie schlagen und heimisch sein nur bei ein paar Grasbüscheln. Als sie sich verliebt, wird sie zunächst nur desto leichter und beschwingter - bis es ihr auf die Flügel schneit, und ausgerechnet die Liebe zwingt sie dazu, sich zu ducken, bis sie schliesslich nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und wirklich ein Pendant zum sterbenden Pedroni: Beweis, dass es auch einen Tod im Leben gibt.
Nina und Pedroni markieren, zusammen mit einem fast immer schweigenden, träumenden Kind, zusammen mit einer weiteren weiblichen Figur, das, was aus der Enge hinausführen, den Alltag übersteigen könnte. Mit ihrer Besetzung steht und fällt die Aufführung. Pedroni wird durch Klaus Degenhard vorzüglich dargestellt, Katharina von Büren dagegen dürfte eine Fehlbesetzung der Nina sein. Niemand glaubt ihr, dass sie «die Flügel locker hält»: sie hat ja keine, sie geht den schweren Gang der Kellnerin, die viel zu viele Schritte tun muss. Damit aber ist die Schwäche der Aufführung an einem Beispiel blossgelegt. Nicht dass die Inszenierung Peter Borchardts am Text vorbeiginge, ihn verfälschte; aber sie dreht ihn zu sehr ins Biedere, Handfeste; es fehlt darin das Träumerische, Luftige, das sogar in den Alltagsszenen steckt. Die Szenen rollen wie feste, kompakte Glaskugeln hintereinander; dass die Marmelsteine im Innern auf irritierende Weise schillern können, sieht man nicht. Im Rückblick habe ich mich sogar gefragt, ob die Autorin dem Stück einen anderen Titel hätte geben sollen: einen luftigen, durchsichtigen.
Elsbeth Pulver
Aargauer Zeitung: Stadttheater Bern mit «Das Marmelspiel» von Maja Beutler im Kurtheater Baden
Gefangene im Netz des Alltags
Maja Beutler hat sich mit ihren Büchern «Flissingen fehlt auf der Karte», «Fuss fassen» und «Die Wortfalle» als Romanautorin einen Namen gemacht. Und sicher bin ich nicht die einzige, die sie als Verfasserin der warmherzigen und gescheiten «Worte zum Tag» am Radio hochschätzt. So war denn das Kurtheater erfreulich gut besetzt, als das Berner Stadttheater mit ihrem zweiten Bühnenstück - das erste, «Das blaue Gesetz», war vor sechs Jahren vom Städtebundtheater Biel/Solothurn aufgeführt worden - drei Wochen nach der Uraufführung in Baden gastierte. «Das Marmelspiel» erhielt übrigens den Welti-Preis 1985 zugesprochen, und ihr neues dramatisches Werk «La donna è mobile» ist eben im Wettbewerb der Zeitschrift «Musik und Theater» ausgezeichnet worden. Um es vorwegzunehmen: Obschon mich im «Marmelspiel» einige Szenen ergriffen und andere erheitert haben, machte sich am Schluss leise Enttäuschung breit. Allzuoft meinte man in den Dialogen das Papier rascheln zu hören, legte die Autorin ihren Figuren Gedachtes in den Mund, das man unausgesprochen hätte erspüren müssen, Maja Beutler scheint den mitdenkenden Bücherlesern mehr zuzutrauen als den Theaterbesuchern und den Schauspielern. Sie lässt ihre Bühnenmenschen ständig erklären und Tiefsinniges äussern, wo sie schweigen müssten, wo das, was sie denken und fühlen, durch das Spiel ausgedrückt werden müsste. Dramatisches hat eben andere Gesetze als Episches.
Das ist ja wohl auch der Grund, weshalb die Pro Helvetia das sogenannte Hausautoren-Modell unterstützt, das Schriftstellern während einer Spielzeit ermöglicht, alle Bereiche des Theaters kennenzulernen. Maja Beutler hat im Rahmen dieser Förderung in Bern hospitiert und, wie sie in einem Fernsehinterview sagte, daraus für ihre Theaterarbeit Nutzen gezogen. Leider, so schränkte sie ein, habe man ihr keine Schauspieler für Experimente zur Verfügung stellen können. Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Über das Hausautoreh-Modell hinaus müssten die potentiellen Dramatiker Gelegenheit haben, direkt mit Schauspielern zu arbeiten. Dann würde eine Maja Beutler selber herausfinden, wo ihre Texte tragen und WO nicht.
Sie zeigt in ihrem Querschnitt durch den helvetischen Alltag dreizehn Figuren, die sich bemühen, mit diesem kräftezehrenden Alltag und mit dem manchmal hart zuschlagenden Schicksal fertig zu werden. Da ist der bescheidene Briefträger (hervorragend verkörpert von Armin Halter), der es seiner Frau so gerne recht machen würde. Doch die kann sich nicht damit abfinden, dass sie es «nur» zur Briefträgers-Gattin gebracht hat. Sie ist halt zu Höherem geboren, malt Spanschachteln und streicht am Abend dem erschöpften Ehemann seine Nichtigkeit aufs Butterbrot. Ihren Ehrgeiz versucht sie am Sprössling zu befriedigen, der es in der Schule unbedingt zu etwas bringen muss. Da ist die früh verwitwete Frau Ingold, deren Sohn vor der mütterlichen Betreuung nach Neuseeland geflüchtet ist. Und da ist die zentrale Figur des liebenswerten Schneiders Pedroni (mit sparsamen Mitteln sympathisch dargestellt von Klaus Degenhardt), der seine tödliche Krankheit mit mehr Fassung trägt als seine verstörte Frau. Nur einmal muckt er auf und verteidigt seine Menschenwürde gegen die über ihn verfügenden Ärzte. Dann legt er sich, ohne seine südländische Heiterkeit zu verlieren, zum Sterben nieder.
Doch auch dem Arzt, der sich nicht für seinen Patienten, sondern nur für dessen Bronchien interessiert, läuft nicht alles rund. Seine hübsche junge Frau (Esther Schweizer) ist vor lauter ungestilltem Liebeshunger dem Alkohol verfallen. Dem Doktor ist abends jedoch mehr nach Nachtessen als nach Trösten der betrunkenen Gattin zumute. Im Gasthaus lässt er sich von Nina bedienen. Die hat allerdings auch ihre privaten Sorgen. Sie möchte mit ihrer neuen Liebe, dem Kunststudenten Franz, in ihr Traumland China reisen. Doch der muss zuerst eine Arbeit abschliessen und mit der Eifersucht des Kunsthändlers Kasser (ausgezeichnet dargestellt von Gabriel Dominik Müller) fertig werden.
Die Quartierbewohner werden von der klatschsüchtigen Frau Wyttenbach (genau gezeichnet von Ingeborg Arnoldi) beobachtet und ungefragt mit guten Ratschlägen versehen. Die sensationslüsterne Moraltante kann aber auch Mitleid empfinden. Es ist fast ein bisschen tragisch, dass ausgerechnet diese belanglose Figur Maja Beutler am stimmigsten gelungen ist! Ein Händler (Hans Heinz Moser) steuert als Unbeteiligter einige sarkastische Bemerkungen bei.
Das Kaleidoskop schweizerischen Alltagslebens in 26 Szenen lässt Peter Borchardtia seiner letzten Regiearbeit - er ist bekanntlich ein Opfer bernischer Querelen und trotz künstlerischer Erfolge als Schauspieldirektor verabschiedet worden - in einem Bühnenbild (Brigitte Friesz) spielen, das von einem Strauch im Hintergrund und blaugestrichenen Schiebetüren im Vordergrund dominiert ist. Die Musik beim Szenenwechsel, entweder klagende Jammertöne oder ein lüpfiger Bierzeltmarsch, unterstreichen das Disparate unseres Lebens, weisen darauf hin, dass Trauriges und Tragisches mit Leichtem und Forschem abwechselt. Das Leben geht immer weiter - die Marmeln rollen unerbittlich und gleichmässig hinunter auf ihrer schiefen Bahn.
Elsbeth Dietrich
NZZ: Leben und Sterben
Auftakt der Berner Schauspielsaison, Uraufführung von Maja Beutlers «Marmelspiel»
B. En. Aus ihrem 1980 erschienenen Roman «Fuss fassen», der Geschichte einer lebensbedrohenden Krankheit, hat die Berner Autorin Maja Beutler die Figur des italienischen Schneiders Pedroni herausgegriffen und sie in den Mittelpunkt eines szenischen Puzzles gestellt. Der Titel «Marmelspiel» meint das Konzept ihres neuen dramatischen Werks: Sechsundzwanzig Szenen sind gleichsam als Marmeln unterwegs, die abwechselnd von den Scheinwerfern angestrahlt werden. Diese kompositorische Organisation erlaubt der Autorin ein zwangloses Spiel mit zahlreichen Lebensmöglichkeiten, wie sie die Bewohner eines Wohnblockquartiers darbieten; ihre Gesten und Sprechmodi, von Maja Beutler überaus hellhörig aufgefangen, verstärken oder kontrastieren von Fall zu Fall das Leben und Sterben Pedronis. Klaus Degenhardt gibt dieser Figur nicht - wie man dies vielleicht auf Grund des Klischees erwarten möchte - das glutvolle Temperament des Sizilianers mit; er spielt diesen Pedroni verinnerlicht, voller Noblesse und diskretem Charme. «Hoffen ist jetzt eine Arbeit», sagt der kranke Italiener im Roman einmal. Auch innerhalb des Dramas verkörpert er unauffällig das Prinzip der Hoff¬nung (wider alle Hoffnung), und dieser Impetus teilt sich den übrigen Figuren mit, auch wenn sie äusserlich scheitern; im Grunde aber markieren sie innerhalb ihres Bereichs sachte Neuanfänge.
Behutsam hat Maja Beutler das Sterben ihrer Hauptfigur in Szene gesetzt, hat diesem Ende jeden effektvollen Schrecken genommen. In dieser Zurückhaltung steckt menschlich-künstlerische Qualität, und auch die kluge Regie Peter Borchardts, der die Uraufführung am Berner Stadttheater übernommen hat, folgt adäquat diesen Absichten. Brigitte Friesz überrascht mit einem ansprechend abstrahierenden Bühnenbild, das bläulich angestrahlte Fassaden in immer neuen Bewegungsvariationen zeigt und den schnellen Szenenwechsel garantiert.
Die einzelnen Kurzsequenzen mochten sich zwar nicht immer durch dieselbe szenische Dichte, die gleiche Ausdrucksstärke auszeichnen; das Werk in seiner Gesamtheit jedoch hinterliess einen starken Eindruck, weil es Möglichkeiten aufzeigte, wie mit dem Leben und Sterben umzugehen wäre. Maja Beutler ist mit diesem ihrem zweiten Drama zudem deutlich über ihren Erstling «Das blaue Gesetz» (1979) hinausgewachsen; ihre Sprache wirkt lebendig, manche Figuren weisen in aller Kürze ein scharfes Profil auf, die szenischen Möglichkeiten werden bewusst aufgegriffen.

|
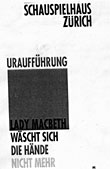 |
Lady Macbeth wäscht sich die Hände nicht mehr
UA 1994 am Schauspielhaus Zürich (Verlag der Autoren
Frankfurt a/Main
|
Nick: Was zum Sebulon…Achtundzwanzig Jahre beisammen und Wurst nie auf dem Tapet?
Hetti: Alles noch vor uns.
Lesebeispiel:

|
- Tagesanzeiger
- Luzerner- und Zuger Zeitungen
- NZZ
Lesebeispiel:

|
|
4. SZENE
Hetti flätzt sich in einen Stuhl und raucht. Es wird in zwei Rucken heller. Autolärm dröhnt auf. Hetti springt auf, faßt die Champagnerflasche; Nick erscheint am Horizont und gähnt. Da lässt Hetti den Korken knallen.
NICK Bist du wahnsinnig?
HETTI Auf uns beide, Nick. (Sie gießt ein.)
NICK Der Schlag hätt mich rühren können.
HETTI Bumm, bumm, Veuve cliquot, lebe hoch.
(Sie hebt ihr Glas.)
NICK Tot könnt ich sein. Und ich Trottel geb mir Müh, dich nicht aufzuwecken.
HETTI Hast du ja nicht. Trink, trink, auf dein starkes Herz, und auf meines. Jetzt fangen wir neu an, Nick, ein halbes Jahrhundert habe ich gewartet. Jetzt, jetzt kommt mein Lebensbaum.
NICK So what.
HETTI Allein kann sich das Glück nicht geben, wie auch, wenn es um beide geht?
NICK Geschwollen daherreden ja. Aber einen Knopf annähen ums Verrecken nicht.
HETTI Ich wünsche mir ...
NICK ... die Wurst an die Nase, von mir aus.
HETTI Nick, ich weiß, daß ich ...
NIC ... daß ich umfallen könnt vor Schlaf weiß ich, daß es nicht geklappt hat mit den Japsen weiß ich, daß ich nach Hamburg muß um 9 weiß ich; und neue Verträge muß ich entwerfen, und um sechs aus den Federn und muß und muß und muß.
Er geht an Hetti vorbei, sie schmeißt die Champagnergläser zu Boden.
HETTI Ja, ja, ja, die Wirklichkeit. Und ich, du Froschkönig? Hab ich keine? Das Türschloß ist zugeschnappt.
Hetti rennt zum Deckel und versucht, ihn abzuheben.
HETTI Hilfe, Hilfe.
NICK Was zum Sebulon ...
HETTI Die Schlüssel, wutsch bumm. Hilfe.
NICK Hör mit dem Gezeter auf. Was Ist wo - ganz sachlich.
Hetti Pluff hab ich des Langen und Breiten erklärt. Samt Anhänger.
NICK Du willst doch nicht sagen ...? Der ganze Schlüsselbund?
HETTI Frag den Gärtner.
NICK Und wieso hätte er ihn nicht raufgeholt?
HETTI Weil der Heizer runtersteigen wollte. Dienstaltersfrage, oder was weiß ich: Konkurrenzneid am Rande des Abgrunds. Ich habe gesagt: Könnt euch so passen, an die Schlüssel geht keiner; Deckel drauf und weg.
NICK Hast du gesagt. So. (laut) Doch wieder einer von deinen Spàßen.
HETTI Nachts um drei? Einverstanden: Bleiben wir draußen.
NICK Gib die Schlüssel. Faust auf.
Hetti streckt die eine Hand aus.
NICK Die andere.
Sie streckt die zweite Hand aus.
NICK Kein wahres Wort, ich könnte ...
HETTI ... Schwör nicht. Es bringt Unglück.
Nick hebt den Deckel, er muß mehrmals ansetzen, weil das Gewicht zu groß ist; als er ihn niederläßt, steht das Loch knapp zur Hälfte offen.
NICK (während der Arbeit) Du bringst mich noch ins Grab.
HETTI Bräuchtest du eine Leiter?
NICK (sperbert hinunter) Was hab Ich gesagt.
HETTI Bräuchtest du den Mond?
NICK Marsch, steig runter und such die Schlüssel selber. Wird's?
Hetti stößt Nick; er tritt auf den Deckel, der unter seinem Gewicht kippt. Nick stürzt schreiend in die Grube; Hetti stupst mit dem Pantoffel den Deckel drüber.
HETTI Fertig, die Wirklichkeit.
5. Szene
NICKS STIMME Hetti, Hetti, Hettiii ...
HETTI Bleib, Nick, bleib, o mein Lieber, ich habe mir nichts anderes gewünscht. Bleib, ich verspreche dir, nie mehr etwas zu wünschen.
MICKS STIMME (schwächer) Hettiii.
HETTI Jetzt geht das Märchen an, luftig, leicht, Nick, schon breiten wir die Flügel aus und fliegen, schschscht, schschscht, wie der Himmel sich weitet; jetzt kann ich atmen, Nick, jetzt komme ich zum Leben, hui, wie das Glück trägt, Lieber, ich werde dich krönen mit meinen Händen, glaub mir, ich lese dir jeden Wunsch von den Augen ab; stelle mich auf die Probe, schnell: Soll der Mond ein zweites Mal aufgehen? soll die Sonne steigen? (Nick stöhnt.) Schscht, Lieberlieber, schscht, du sollst es nicht bereuen, und morgen nicht, und morgen - dieses Fest. Wo ist dein Schuh aufgetreten? (Sie leckt den Deckel.) Jeder Schritt mir;
(Sie spielt einen Liebesakt.) ja, reiss mir die Lippen auf; du Kratzbürster, bockiger, hui, fetz mir die Haut herunter, Eisbrocken, Steinklotz, ich breche dich auf, Kindsvertreiber, Scherbenrichter, ich sprenge dich in die Luft.
Die Sonne geht auf.
Überstanden. O, mein Pinselchen, o, mein Schreihälschen, o, mein Tolpätschchen, o, mein Nimmersättchen, mein Hungermäulchen, steh auf, Nick, der erste Tag. 'Und er sah, daß es gut war’, werde ich am Abend sagen. Jetzt bin ich die rechte Frau.
6. Szene
HETTI ist gerädert von ihrer Liebesnacht auf dem Deckel und kann erst nach mehreren Anläufen aufstehen.
HETTI (noch am Boden) Laß, Nick, laß, nicht Schabernacken jetzt. Weiß ich nicht am besten, was er jetzt braucht, mein Mann?
HETTI eilt davon und kommt In einem königlichen Morgenmantel und hochhackigen Federpantöffelchen zurück. Nick sitzt am Tischchen, in seinem Trainingsanzug. Er wird nicht essen und trinken oder Gegenstände berühren.
HETTI Hab ich zuviel versprochen? Ich hatte doch längst vorgesorgt.
NICK Man muß nur wollen.
HETTI Du hast recht, und alles erst ein kleiner Anfang.
Sie geht zum Horizont, beugt sich drüber und zieht die Zeitung und eine Tüte mit Brötchen herauf.

Tagesanzeiger | Luzerner- und Zuger Zeitungen | NZZ
Lieber Bonsai als einen Plastik-Dschungel
Tagesanzeiger: Trotz Protest ist Maja Beutlers neues Stück am Zürcher Schauspielhaus uraufgeführt worden.
Von Skandal nicht die Spur: Im Zürcher Schauspielhaus wird kein Meisterwerk malträtiert. Andreas Herrmanns Inszenierung von Maja Beutlers «Lady Macbeth wäscht sich die Hände nicht mehr» ist eine mögliche Lesart des neuen Stücks. Das Premierenpublikum schien es ähnlich zu sehen. Es applaudierte kurz, aber kräftig.
VON PETER MÜLLER
Aus Protest zeigte sich Maja Beutler nicht bei der Uraufführung (TA von Donnerstag). Sollen wir sie darum einfach im Schmollwinkel stehenlassen? Das wäre zu einfach. Die Autorin hat sich an ihrem Berner Schreibtisch etwas anderes vorgestellt, als was jetzt auf der Schauspielhausbühne zu sehen ist. Der Stücktext belegt es.
Rotkäppchen frisst Wolf
Die Geschichte der Hetti Bickel, die an ihrem 50. Geburtstag den Manager-Gatten Nick in den Schacht des Öltanks schubst, um endlich die grosse Liebe mit ihm zu leben, ist als absurdes Traumspiel angelegt. Schräg und schrill, handfest und versponnen, poetisch und trivial. Ein Kopf- und also auch ein Sprachstück. Während sich die Männer mit kurzatmigen Phrasen begnügen, wuchert die Sprache der Frau, assoziativ und bildhaft, Kinderreime, klassische Zitate, Bibelsprüche und Grimms Märchen sollen sich lianenhaft ineinanderschlingen, zu einem Worturwald verwachsen, in dem es nicht mehr erstaunt, wenn die Prinzessin ihren Froschkönig unterm Schachtdeckel begräbt und das Rotkäppchen seinen Wolf frisst.
So war das wohl gedacht. Nur fehlt Maja Beutler die Sprachkraft für tropisches Gewächs. Der verbale Urwald, der im öden Garten der Bickelschen Industriellenvilla spriessen soll, gleicht eher einer Baumschule, und die üppigen Seelenblüten stellen sich meist als Plastikorchideen heraus.
Der Regisseur als Förster
Aus dem Regisseur Herrmann wird darum zunächst ein Förster. Mit der Motorsäge beschneidet er resolut den Wildwuchs. Ein Viertel des Textes fällt. Bonsai heisst Herrmanns Devise, lieber ein echtes Zwergbäumchen, als einen Dschungel aus Kunststoff. Damit schrumpft auch Hetti. Keine Penthesilea der Goldküste wütet auf der Pfauenbühne, das Monströs-Groteske, Wild-Böse, das Maja Beutler ihrer Heldin zugedacht hat, wird kanalisiert. Zu sehen ist die psychologische Studie einer frustrierten Ehefrau, die ihren Mann ganz für sich haben will, und sei's als Toten.
Beutlers Traum vom grossen dramatischen Bogen gibt die Zürcher Inszenierung auf. Kurze Szenen reihen sich filmartig aneinander, Facetten, Stimmungen der unglücklichen Glückssucherin Hetti. Grelle Effekte und Klamottenscherze, zu denen der Originaltext einlädt, versagt man sich. Massvoll ist im Schauspielhaus alles, dezent und diszipliniert. Mit vereinten Kräften wird versucht, aus einer ambitiös verunglückten Vorlage ein brauchbares Theaterstück zu machen. Die Kräfte am Werk sind nicht gering. Sascha Gross hat eine Bühne und Kostüme entworfen, die einleuchten. Der Garten der Bickelschen Villa ist eine künstliche Insel, rauh und abschüssig gegen die Rampe hin, gepützelt im Innern. Hettis Traum vom Fliegen ist zu kitschig vergoldeten Reihern erstarrt. Der leere Sandkasten, in dem nun der Frühstückstisch steht, erinnert an früheres Leben.
Starke Schauspieler
Peter Arens spielt Nick und die sechs Männer, in denen Hetti immer nur den toten Gatten sieht. Er braucht die von Beutler vorgeschlagenen Masken, Schnäuze, Bärte nicht, um die Figuren klar voneinander abzuheben und sie sich doch gleichen zu lassen. Ob er als Manager, Chauffeur, Heizer oder Kriminalkommissar auftritt, dem Schauspieler genügen mimische Veränderungen in Stimme und Körperhaltung, und die Lacher sind ihm doch sicher.
Am schönsten ist sein Gärtnermeister Ruckstuhl. Er bringt Hetti die obligaten Geburtstagsrosen, auf die Gatte Nick abonniert ist, und lässt sich von Frau Generaldirektor zu einem Stück Torte einladen, halb geschmeichelt, halb unwillig, weil das Geschäft ruft, und immer mit dem Strauss in der Hand. Mehr und mehr lässt sich der solide Gewerbler von Hetti in ihre Rollenspiele verwickeln, mit offenem Mund, staunend über sich selbst, posiert er schliesslich für ein Foto als ihr Geliebter, küsst sie plötzlich und weiss nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.
Cornelia Schmaus ist Hetti. Wie sehr die (Ost-)Berliner Schauspielerin ihr Handwerk beherrscht, weiss man in Zürich seit ihrer Judith (von Hebbel). Kalkül und Intensität gehen eine Verbindung ein, die Eindruck macht. Nichts wirkt zufällig oder auch nur unkontrolliert. Da ist viel Kraft, hochgespannt und gebändigt.
Schmaus gibt der Hetti zahlreiche Gesichter und hält die Figur doch energisch zusammen. Verhärmt und kokett kann sie sein, kleinlaut und triumphierend, nachdenklich und aufbrausend, tänzelnd leicht und schwer wie ein Kartoffelsack. Bald scheint Hetti in ihrem romantischen Liebeswahn verloren, bald steht sie fest und listig mit beiden Pelzpantoffeln auf dem realen Boden.
Bewundernswert ist Schmaus' Umgang mit der Sprache. So viel Sorgfalt und Präzision sind selten geworden auf deutschsprachigen Bühnen. Ihren Höhepunkt hat die zweieinhalbstündige Aufführung denn auch bei völlig dunkler Bühne. Im Liebesakt mit dem toten Nick brechen die gestauten Wünsche mit einer Wucht aus Hetti, die für einen Moment berührt.
Im übrigen kann selbst Cornelia Schmaus nicht verhindern, dass Hetti kalt lässt. Nach zügigem Beginn scheint das Stück stillzustehen, es bringt nur noch Variationen, dümpelt ziellos vor sich hin. Der abrupte Schluss ist so schwach wie verräterisch. Maja Beutler sollte nicht schmollen, sondern sich die Zürcher Uraufführung genau ansehen. Vielleicht geht sie dann nochmals über ihren Text. Oder sie lässt das Stückeschreiben ganz sein.
Luzerner- und Zuger Zeitungen: Per Gattenmord zur Freiheit?
Maja Beutlers «Lady Macbeth wäscht sich die Hände nicht mehr»
Zürich - Von der versuchten Selbstbefreiung einer 50jährigen Frau mittels Ermordung ihres Ehegatten handelt Maja Beutlers Theaterstück «Lady Macbeth wäscht sich die Hän¬de nicht mehr», das am Donnerstag im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde. Andreas Herrmanns Inszenierung, von der sich die Autorin zwei Tage vor der Premiere vehement distanzierte, zeigt eine Frau, die in kühler Selbstbeherrschung am Rande des Wahnsinns einen Neuanfang wagt... und scheitert.
• Von Hugo Bischof
Der junge deutsche Gastregisseur identifiziere sich zu sehr mit dem Schicksal der gattenmordenden Frau und inszeniere die Geschichte lediglich als Krimi, liess die Schweizer Schriftstellerin Maja Beutler in einem der Presse zugesandten Communiqué verlaUten. Sie sei nach Probenbesuchen erstaunt darübergewesen, «wie viele Freiheiten ein Regisseur und wie wenig Freiheiten ein Text hat».
Krimiatmosphäre
In der Tat: Eine TV-Krimi-Atmosphäre der gepflegten Art herrscht von Anfang an in Andreas Herrmanns Inszenierung. Das wurde sofort klar, als sich am Donnerstag im Schauspielhaus vor gespanntem Publikum (und in demonstrativer Abwesenheit der Autorin!) der Vorhang hob. Alles ist da, was wir aus «Kommissar», «Tatort» und dem «Alten» kennen: steriler Luxusvilla-Garten (mit Swimmingpool-ähnlicher Frühstücksveranda und drei Meter hohem schalldichtem Zaun), seichte Popschnulzenmusik, Designer-Gartenmöbel und dazu der Ruch von tödlicher Ehe-Langeweile. Man wäre nicht überrascht, tauchte aus den Kulissen Derrick auf und begänne mit durchdringendem Blick die Suche nach Motiv und Mörder.
Schon im Bühnenbild (Sascha Gross) setzt die Zürcher Inszenierung eigene Akzente und weicht von Maja Beutlers Regieanweisungen ab. Wo die Autorin eine «Ödnis» verlangt, die zum Horizont ansteigt, «wo Sonne und Mond auf- und untergehen», da erhebt sich im Schauspielhaus hinter dem hermetisch abgeschlossenen Garten bei Bedarf ein kitschiger Sternenhimmel. Und ein Bühnenkran mit Suchscheinwerfer dreht als Mond beziehungsweise Sonne seine Ellipsen... und äugt als neugieriger Betrachter über den Zaun. Das macht durchaus Sinn und ist auch witzig.
Vernachlässigte Ehefrau
Maja Beutler stellt in ihrem dritten Theaterstück (nach «Das blaue Gesetz» und «Marmelpiel») eine Frau vor, deren Problem gewöhnlicher kaum sein könnte: Hetti Bickel, die eben 50 Jahre alt gworden ist, fühlt sich von ihrem Ehemann Nick, einem dauergestressten und mehr oder weniger erfolgreichen Manager, vernachlässigt. Ihre Lösung des Problems ist einfach, und sie vollzieht sie gnadenlos und ohne Reue: Als Nick eines Nachts wie gewohnt sehr spät nach Hause kommt (von der Arbeit? von einer seiner Freundinnen?), stösst sie ihn in den Öltank in ihrem Garten und schliesst den Deckel.. «Fertig, die Wirklichkeit», sagt sie.
Der erste spontane Premierenapplaus just an dieser Stelle bewies es: Die Autorin hat eine höchst lebendige weibliche Figur geschaffen, welche die Sympathien trotz verbrecherischer Impulse auf ihre Seiten zu ziehen vermag. Kein Wunder: Der Mann, so wie die Autorin ihn in diesem Stück zeichnet, ist ein jämmerlicher Winzling, der unentwegt leere Phrasen drischt und über dessen Verschwinden eigentlich niemand so richtig traurig sein kann. Dass namhafte Schauspielerinnen in Deutschland es abgelehnt haben sollen, die Hetti zu spielen, kann eigentlich nur verwundern. Viel eher müsste wohl der Darsteller des Nick an seiner Rolle verzweifeln.
Anstatt der erhofften Freiheit beginnt jedenfalls für Hetti nach der schnöden Tat - ob Nick beim Sturz stirbt oder anschliessend kläglich verhungert, wird übrigens weder aus Beutlers Text noch aus der Inszenierung klar - ein Alptraum: In jedem Mann, der ihr von jetzt an begegnet, erkennt sie ihren verstorbenen Gatten - ob im Chauffeur, Gärtner, Kriminalinspektor oder im eigenen Sohn.
Kein durchgängiger Theaterabend
Der Anfang von Maja Beutlers Schauspiel ist vielversprechend. Und im Verlauf der rund zweistündigen Aufführung ergeben sich weitere starke Momente. Hettis Suche nach ihrer Identität, ihre Träume von Macht und von der Übernahme der geschäftlichen Funktionen ihres Mannes, auch ihr seltsam-unsicheres Bemühen um Vertuschung des Mordes - das alles wird von der Autorin mit grossem sprachlichem Einfühlungsvermögen geschildert. Nur wollen sich die einzelnen Szenen und Handlungsfetzen nicht zu einem durchgängigen Theaterabend verdichten.
Regisseur Herrmann gibt sich Mühe, versucht allzu vordergründige Lösungen (die in Beutlers Text zuweilen angelegt sind) zu vermeiden und schafft einige schöne Bilder. Cornelia Schmaus spielt die Hetti in brillanter Manier als eine Frau, die sich zusehends in ihrer Traum- und Wunschwelt verstrickt und immer kommunikationsunfähiger wird. Peter Arens spielt Nick und sämtliche Nick-Doppelgänger mit nonchalanter Routine. Was die Textgenauigkeit dieser Inszenierung betrifft: Regisseur Herrmann hat zwar recht viel gekürzt, eine Verfälschung der Aussage, wie es die Autorin geltend macht, ist jedoch kaum nachzuweisen.
NZZ: Szenen keiner Ehe
Ein Achtungserfolg für Maja Beutlers «Lady Macbeth...»
«So what?!» pflegt Maja Beutlers Theaterfigur Nick Bickel in jeder Lebenslage zu knurren. «So what?» fragen wir uns nach der Uraufführung des Stückes «Lady Macbeth wäscht sieh die Hände nicht mehr». - Seit Tagen schon hatte man es im Schauspielhaus Zürich bedrohlich rumoren hören, und pünktlich zur Premiere wurde der Theaterkrach perfekt, will sagen publik: Maja Beutler und ihr Verlag distanzierten sich in Mediengesprächen von der Inszenierung Andreas Herrmanns (vgl. NZZ Nr. 251). Woher aber die Aufregung?
Die Uraufführung gab keinen Aufschluss darüber. Der junge Regisseur führte das Publikum am Donnerstagabend auf einen gangbaren Weg durch ein schwieriges Stück, dessen Vorzug gerade in der Vielfalt seiner Interpretationsmöglichkeiten liegt. Herrmann entschied sich für eine denkbare Variante unter vielen und gab Beutlers Vorlage die entsprechende dramaturgische Linie: mit Kürzungen, die qualitativ wie quantitativ nachvollziehbar erscheinen. - Das Resultat: ein interessanter Theaterabend, nicht mehr und nicht weniger. Das Premierenpublikum applaudierte freundlich allen Beteiligten mit Ausnahme der Autorin, die der Aufführung erwartungsgemäss fernblieb. Maja Beutler war mit ihrer Haltung - von wem auch immer - schlecht beraten. Sie hat sich einen Achtungserfolg entgehen lassen für die valable Uraufführung ihres valablen Stückes. Und sie hat den Gegnern ihres Schaffens und den Gegnern der Schweizer (Frauen-) Dramatik billige Argumente in die Hände gespielt.
«Lady Macbeth wäscht sich die Hände nicht mehr» war zunächst der Titel einer etwas dünnen Erzählung, die Maja Beutler 1989 im Rahmen der Prosasammlung «Das Bildnis der Doña Quichotte» veröffentlichte. Der zwanzigseitige Text skizziert bruchstückhaft die Szenen keiner Ehe: die totgelaufene Beziehung von Herrn und Frau Bickel, die sich nur mehr morden möchten, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Der Grossindustrielle Nick Bickel will seine im Lauf der Jahre von der wichtigen Weggefährtin zur lästigen Gattin mutierte Hetti bloss loswerden, und Hetti wünscht sich von Nick eigentlich nichts als sein schlichtes Vorhandensein. Allerdings wünscht sie sich das immer kompromissloser und schliesslich mit Gewalt: In der Nacht zu ihrem 50. Geburtstag versenkt Hetti den zwischen zwei Flugzeugen (und zwei Freundinnen) nach Hause geratenen Gatten im Garten bzw. im daselbst verbuddelten Heizöltank. Mit dem toten, aber dadurch häuslich gewordenen Nick kann sie nun im poetischen Zwiegespräch die neue Zweisamkeit auskosten. Bis die alte Realität einbricht und Hetti die Flucht nach nirgendwo ergreift.
Rollentausch
Maja Beutlers Dramatisierung des Stoffes geht jenen Schritt weiter, der in der Erzählung erst angedeutet wird: Hetti Bickel versucht den Rollentausch. Statt sich nach Nicks Abgang über das aus den Fugen geratende Industrieimperium zu mokieren, greift sie selber nach dem Zepter. Doch wie sie sich auch dreht und wendet: in jedem Gegenüber tritt ihr der Dahingegangene entgegen (weshalb Maja Beutler alle diese Rollen dem gleichen Schauspieler zuschreibt). Ob der Gärtner oder der fahndende Kommissar, ob Nicks Verwaltungsratskollege oder der heimkehrende Sohn des Hauses, immer sieht Hetti jenes im Öltank verschwundene Mannsbild vor sich, das ihr Weltbild offensichtlich unkorrigierbar geprägt hat.
In der Konfrontation mit der führerlos gewordenen Firmenspitze fördert Hetti zwar zunächst noch brockenweise verschüttetes Selbstwertgefühl zutage, lässt nach langer Zeit wieder so etwas wie Handlungsfähigkeit erkennen (immerhin hat sie einst mit Bickel selig den Grundstein zum Multiimperium gelegt). Aber das reicht nicht, denn dieselben Witzfiguren, die bisher epigonal um den grossen Bickel kreisten (lauter kleine Nicks), entwickeln angesichts von «Frau Direktors» Aufbruchstimmung harsche Abwehrreflexe. Schliesslich ruft der verwaiste Verwaltungsrat notfallmässig den «verlorenen Sohn» heim nach dem Motto: lieber einen Nestbeschmutzer vor der Nase als eine aufmüpfige Witwe am Hals.
Es braucht gerade noch diesen jungen Mann (ein kleiner Nick), der seiner Mutter jetzt ihr langes Ausharren im Familienphantom vorwirft, und Hetti gibt ihren letzten Lebensversuch auf.
Maja Beutler geht es nicht darum, irgendwelche männliche Machtmechanismen dar- oder blosszustellen. Vielmehr zeigt sie das Scheitern von Verständigungsversuchen. Während Nick und seine Duplikate die Sprache ausschliesslich brauchen, um ihre Welt in Ordnung und ihre Wirtschaft in Schwung zu halten, sieht Hetti im rhetorischen Querulantentum eine letzte Chance, sich Gehör, und eine gemeinsame Denkpause zu verschaffen. Sie will Nick (und seine Nachredner) um jeden Preis irritieren. Dazu nimmt sie die Männer beim Wort, bei ihren Stereotypien, um diese in neuem Kontext vollends ad absurdum zu führen. Vergeblich: Trotz den Zitaten haben die beiden Sprechebenen keine Schnittfläche. Und kommen sich doch mal zwei Sätze in die Quere, entsteht höchstens ein Scheindialog, der zwangsläufig in einen Witz mündet. - Kunstvoll erzeugt die Autorin mit dieser Technik eine Komik, die den bleiernen Lauf der Tragödie gezielt zum Stolpern bringt. So perforiert sie das Gewicht einer Geschichte, welche andernfalls altbacken, gekünstelt und parteiisch wirken könnte. Der Witz relativiert das etwas stilisierte Frauenschicksal, und er sprengt eine grob skizzierte Männerwelt.
Dieses pausenlose Schwanken des Textes zwischen schwerblütiger Poesie und subtiler Komik liest sich leicht. Auf der Bühne indessen bedeutet es Schwerstarbeit. Die hervorragende Cornelia Schmaus führt uns während zweieinhalb Stunden herum in Hettis seelischem Steinbruch, dessen einsame Ausbeutung im jahrzehntelangen Tag-und Nachtbau sämtliche Substanz weggefressen und nur mehr Geröll und ein paar Hoffnungskiesel übriggelassen hat.
Während Maja Beutlers Figur der Hauch des Konjunkturopfers aus den sechziger Jahren anhaftet, kauert, kämpft und krepiert auf der Schauspielhausbühne eine zeitlose Karteileiche im Zettelkastensystem der nach wie vor gültigen männlichen Gesellschaftsordnung.
Der tritt wie aus einer fremden Galaxis Peter Arens als vervielfachter Nick entgegen. In einer in ausgesuchter Schöner-Wohnen-Scheusslichkeit drapierten Gartensitzplatz-Kulisse (Ausstattung: Sascha Gross) sehen wir mit Hettis Augen alle paar Minuten das gleiche Gesicht an einem andern Mann. Solide und ohne viel Charge exerziert Arens die Identitäts- und Idiomwechsel durch: vom leibhaftigen Direktor Bickel über den erdigen Gärtner, den schnittigen Chauffeur, den wässrigen Kommissar, den hirnlosen Verwaltungsrat und so weiter bis zurück zum regelmässig auftretenden Geist des Gemeuchelten, der Hettis Scheinwelt jetzt zwar ungeteilt zur Verfügung steht ohne aber mehr als die alten, repetitiven Stichworte liefern zu können.
Ein schwerwiegendes Manko haftet der im ganzen gelungenen Aufführung allerdings an: Dieser Nick Bickel ist einfach zu harmlos. Weder Peter Arens noch die sonst stringente Regie bringen es fertig, die ganze Lebensfeindlichkeit eines blutleeren Dow-Jones-Jüngers spürbar zu machen. So spielt Cornelia Schmaus mit ihrer Hetti Macbeth, die übrigens bis auf ein paar Anspielungen nichts mit Shakespeares Powerfrau gemein hat, einen Abend lang gegen ein Mannsbild an, das mehr Behauptung als Realität ist. Das allerdings tut diese brillante Schauspielerin sehenswert.
Richard Reich

|
| |
Minidramen |
1) Die unverstandene Frau
2) Das vierte Reich
3) Lust – ein Spiel
3 Lesebeispiele:

|
|
bestellen ...
|
Die unverstandene Frau | DAS VIERTE REICH | Lust - ein Spiel
Die unverstandene Frau
Die Souffleuse reckt ihren Oberkörper aus dem Kasten und wendet sich ans Publikum.
SOUFFLEUSE: (flüsternd) Endlich ein Drama für mich!
DAS VIERTE REICH
Ein Stück Volkstheater
Aus allen Lautsprechern schallt irritierendes Zikadengezirpe. Eine riesige Ultraviolettlampe hängt im leeren Himmel und bestrahlt die Sahara. Zu beiden Seiten stehen Plasticpalmen aufgereiht, neben jeder surrt ein Ventilator, der die Wedel leise bewegt.
Drei Schwarze schleppen am Horizont weisse Papiersegel an Tauen über einen blauen Strich.
Im Zentrum sind die drei gigantischen Pyramiden aufgebaut: Vielstöckige Holzgestelle, in denen dichtgedrängt Frauen-, Kinder- und Männerstatisten geröstet werden; alle nackt auf dem Bauch, die Füsse dem Publikum zugewandt. Diese Idylle verändert sich, nach zeitlicher Absprache mit Neckermann: Es dunkelt ruckweise ein, die Schwarzen lassen die Taue fahren, die Segel kippen, das Zikadengezirpe reisst ab. Sämtliche Statisten beginnen im selben Augenblick Kartoffelchips aus Papiertüten zu mampfen. Alle knüllen das Papier gleichzeitig zusammen und werfen es in die Wüste. Die Schwarzen fassen Skistöcke und spiessen den Unrat auf.
Erneuter Lichtwechsel: Der Himmel ist mit Leuchtpunkten übersät; sie sind zur Milchstrasse geordnet, und die Ultraviolettlampe wird auf Infrarot geschaltet: Ein warmer Vollmond glimmt über den Pyramiden. Sämtliche Statisten schalten mit der linken Hand über ihrem Kopf ein Nachtlämpchen ein; dann wälzen sie sich im Gleichtakt auf den Rücken und schnellen mit dem Oberkörper hoch. Alle tragen Walkman-Kopfhörer und eine pechschwarze Quarzbrille. Nach 55 Sekunden fassen die Urlauber mit der rechten Hand nach einer Zahnbürste, mit der linken nach einem Wasserbecher und beginnen, ihre Zähne zu rubbeln. Alle gurgeln im Chor und spucken den Negern vor die Füsse. Dann gähnen sie und legen sich zurück. 12 Sekunden später ertönt der erste Nachtigallenschluchzer ab Tonband; die Urlauber löschen ihr Nachtlämpchen. Nach 20 Sekunden erbeben die Gestelle, die Statisten legen sich paarweise aufeinander und beginnen in rhythmischen Zuckungen im Chor zu stöhnen, die Kinderstatisten rufen: „Mama, ich habe Durst, Papa, ich habe Angst“, das Nachtigallengeschluchze reisst nicht ab. Eine Minute später wälzen sich die Statisten zurück auf ihre angestammten Plätze, die Kinder schweigen. Nach 50 Sekunden kommt auch das Nachtigallengeschluchze zum Erliegen. Die nächste Vorstellung beginnt, wenn aus allen Lautsprechern wieder irritierendes Zikadengezirpe einsetzt und die riesige Ultraviolettlampe am leeren Himmel die Sahara bestrahlt.
Lust - ein Spiel
Die Frau, mit Stecknadeln im Mund, heftet grossblumigen Stoff an eine Schneiderpuppe. Der Mann sitzt am Tisch und spitzt einen Bleistift. Zuweilen schaut er zur Frau und schnippt mit den Fingern. Sie schüttelt jedesmal heftig den Kopf.
FRAU Mmmmmmmmmmmmmmm
MANN Wenn ich aber will?
Die Frau arbeitet ungerührt weiter, der Mann schnippt inständiger. Plötzlich nimt die Frau die Nadeln aus dem Mund und schreit.
FRAU Mich nicht. Verstanden?
Türenschlagend geht sie ab; der Mann ist mit einem Sprung bei der Puppe und stösst ihr den Bleistift in den Bauch. Sie fällt krachend zu Boden, der Mann zieht seinen Bleistift heraus, spitzt ihn sofort neu zu; die Frau reisst die Tür auf.
FRAU Schon wieder?
Sie inspiziert die Puppe.
FRAU Mitten durch die Blume!
MANN Möchtest du’s mitten durchs Herz? Klar! Steht fünfundzwanzig Jahre Knast drauf.
Sie stellt die Puppe auf, er schnippt mit den Fingern.
MANN Hast du überhaupt ein Herz?

|
| |
Macbeth oder ein Regisseur zu Gast in Bern
unveröffentlicht
|
Alles voller Geranien, und die Fahnen stets ausgehängt – Mensch, das müsst man bespielen, das Ganze.
Lesebeispiel:

|
|
|
Macbeth oder ein Regisseur zu Gast in Bern
Kinder, Kinder, die Berner hocken doch alle im Sarg. Oder isses ein Schlund, ein schwarzer, und wir spielen den Magen? Da müssen sie zuschauen, wie’s geht: Verdauung. Kennen sie ja nicht, wat, nur runterschlucken und runterschlucken. Was willst de auch anderes anfangen mit deinem bisschen Leben in diesen historischen Gassen, nicht, alles voller Geranien, und die Fahnen stets ausgehängt – Mensch, das müsst man bespielen, das Ganze. Und andererseits … Ich hab geträumt von Bern, heute Nacht, Tatsache, macht mich unruhig, diese ganze Verdrängung. Ich stand am Fenster der Probenbühne und hab mal kurz rausgeschaut auf die putzigen Dächer, und plötzlich blitzt ne Leuchtkugel auf und ich denk: Mensch, jetzt isses passiert, ausgerechnet hier: der Atomblitz – die gehen alle zugrunde.
Auch wenn de’ s wach überlegst: Diese Grossraumbürotypen, die ein Leben lang nur versuchen, sich beim Psychiater mit der Klimaanlage zu identifizieren – aber wenn de mal zufällig zu tun hast, erotisch meine ich, mit so ner Grossraum-Lohnempfängerin, dann haut’ s dich in Stücke vor dieser Flut zurück gestauter Triebe. Siehst de, Birgitte, so musst de die Lady Macbeth spielen, von dieser Tendenz aus: Ein Vollblutweib, das nie zum Zug kam. Reiss mal die Fahnen runter und scheiss auf den Marktplatz – der Glanz des Bösen, gell.
Aber nicht klein werden mit dem Ehrgeiz, Brigitte, sonst kriegst de die Weiber nicht auf deine Seite: Schrei bloss raus, was sie denken. Vielleicht ist er bloss Prokurist, und sie möchten als Frau Direktor sterben. Nee,nee, halt, Brigitte, halt, was anderes müsstest du schon reinbringen. Was Grösseres, gewaltig, den Hieb ins Firmament. Na, improvisier erst mal die Textstelle :
‚Wo du gross raus möcht’st, da möcht’st du heilig raus, möcht’st nicht falsch spielen und doch fälschlich siegen’ -
ist DIE Schweizer-Stelle im Shakespeare, nicht, spiel sie mal einfach, wie wenn die zur Welt gehören würden. Könnten sie sonst kippen?

|